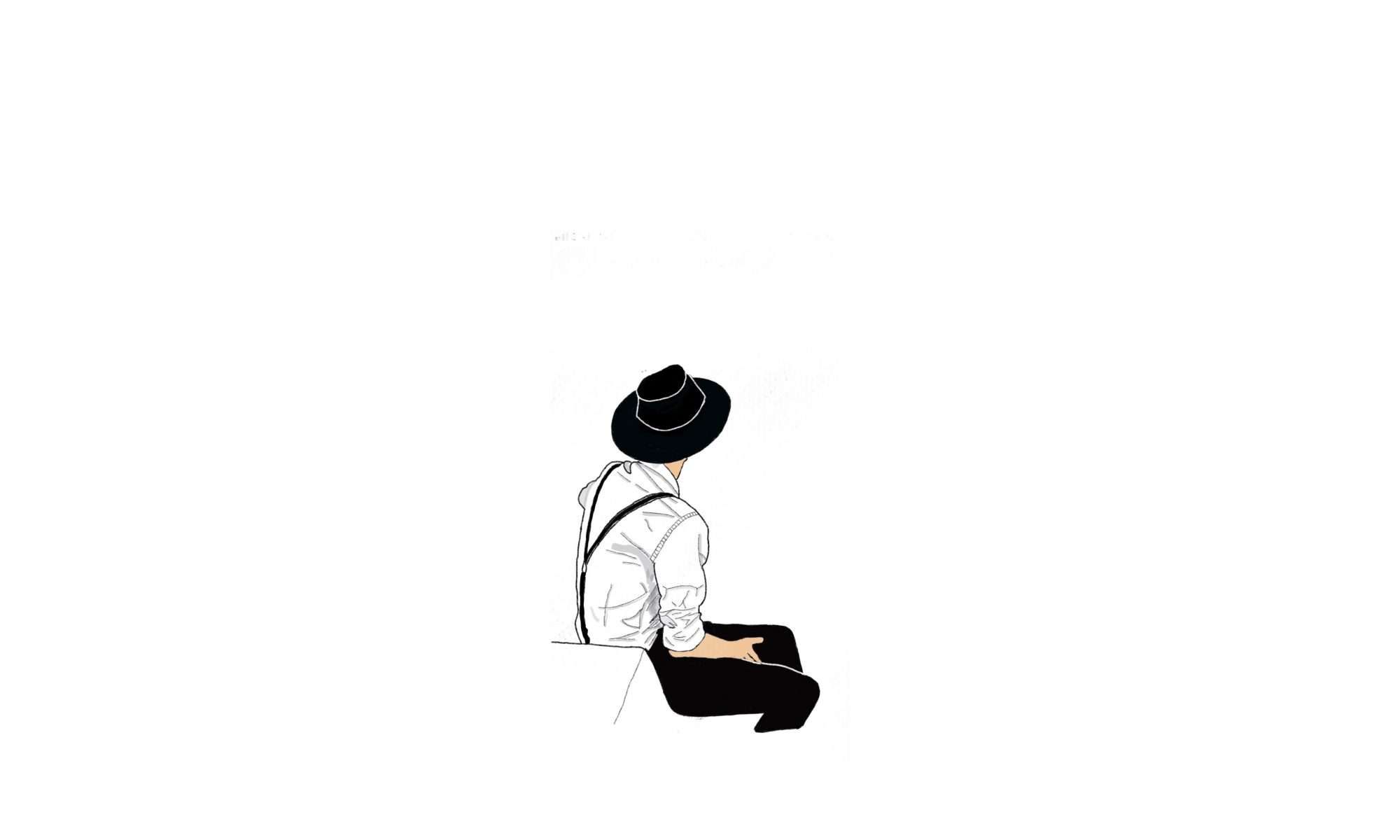„Vor den Trümmern der Existenz stehen“ ist vielleicht eine zu große Formulierung, für das, was da vor Klaudia liegt. Es sind tatsächlich Trümmer, Ziegel, Rohre, Bauschutt. Zweihundert Meter Luftlinie (nunmal tatsächlich), fünf Meter über dem Boden war ihre Wohnung, in der sie die letzten – Klaudia muss nachdenken – 38 Jahre gelebt hatte, in der sie sich eingerichtet und eigentlich wohlgefühlt hatte. Die Wohnung war nicht groß, aber von Dimension und Aufteilung immer ideal für Klaudia gewesen.
Und Klaudia hatte eine eigene Gartenparzelle, gar nicht so klein, denn das grundlegende und besondere Feature dieser Siedlung war, dass zwischen den Häusern ein großer Grünbereich mit gemeinschaftlich genutzten Gärten existierte, die nicht nur zur freundlichen Anmutung der Umgebung sondern auch zur Gemeinschaft einiges beitrugen. Der Garten war, also der war irgendwo hier, ungefähr dort, wo jetzt die Garagenausfahrt ist. Die Autos fahren vor Klaudias Augen quasi über ihre Salatköpfe. Es schmerzt, aber Klaudia wollte sich „ihre Siedlung“ nochmal ansehen, im ruinierten Zustand.
Dort wo früher andere Teile des Gartens standen, stehen nun genormte Hochbeete (70 x 100 Zentimeter), wo jede Wohneinheit ihr eigenes Gemüse oder ihre eigenen Kräuter anbauen kann, natürlich mehr als Hobby als zur Selbstversorgung, aber – dies wohl der Gedanke der Wohngesellschaft – schließlich kaufen die Leute ihr Obst und Gemüse sowieso beim Spar oder Billa oder … Gibt es eigentlich noch etwas Anderes? Ist der Lebensmittelhandel tatsächlich von zwei (2!) Handelriesen bestimmt? Und wie wirkt sich das auf die Preise aus? Aber daran darf Klaudia gar nicht denken, abschweifen von ihrer Wehmut, die vielleicht etwas putzig wirken mag, aber eigentlich nur als Zündmoment ihrer unbändigbaren Wut dient. Während alles um sie herum sich weiter abbaute, hatte die Wut genug Gelegenheit sich richtig groß aufzubauen. Wenn Klaudia diese Wut visualisieren müsste, wäre sie ein feuerspeiender Gozilla, der die Neubauten plattmacht. (Natürlich erst nachdem sich keine MieterInnen mehr im Hochhaus befinden.)
Wann hatte das angefangen? Und warum? Vielleicht nach Beschwerden der MieterInnen, dass die schon dringend notwendigen Sanierungen endlich mal gemacht werden sollten. Der Hausputz war stellenweise schon abgeblättert, in manchen Kellern war es zu feucht, der Schimmel drohte um sich zu greifen. Aber auf die Beschwerden wurde nicht reagiert, vielleicht weil der Plan, hier alles abzureißen und stattdessen neue Hochhäuser zu bauen, längst beschlossene Sache war. Eine achtsame Sanierung wurde nicht angedacht. Am Reißbrett alles schon vorbereitet, am Abreißbrett. Irgendwann kamen die Bagger, der erste Teil der Siedlung wurde zerstört, dann ein weiterer, nach der Reihe fielen die Gebäude, sie fielen der Phantasielosigkeit zum Opfer.
Wohngesellschaften sind, spätestens wenn sie nicht mehr rein von öffentlichen Stellen geführt werden, menschenverachtende Institutionen, die nicht mehr die BewohnerInnen, deren Wohlbefinden, sondern nur noch Profit und Effizienz in den Mittelpunkt ihrer Planung stellen. Bei privaten Wohnprojekten ist das meist die Regel, aber umso verwerflicher ist es, wenn diese Prinzipien immer und überall zur Anwendung kommen.
Mit falschen Versprechungen hatte man die BewohnerInnen dazu gebracht freiwillig ihre Mietverträge aufzulösen und sich in neue Mietverhältnisse zu begeben. Mehr Raum, bessere Standards, leistbare Mieten wurden versprochen. Je nach Sichtweise wurden Punkt 1 und 2 gehalten. Tatsächlich gibt es in den Neubauten, die die Grünflächen unter sich begraben, mehr Platz, denn die Wohnungen sind größer und da man in die Höhe stapelt – auch nur ein Ding der Sichtweise – auch mehr Raum und die Wohnungen entsprechen auch heutigen Standards, was Wanddicke und Fensterdichte (und wasauchimmer man als Standard sieht) anbelangt.
Doch die Bauten werfen ihre Schatten und deswegen sieht man die Sonne eben nicht mehr so häufig durch das Fenster scheinen, aber vielleicht ist das ein natürlicher Standard, der aktuell nicht mehr zählt, weil ja jederzeit das Licht eingeschaltet werden kann, mit dem Strom, der durch die tipptopp verlegten Leitungen vom ersten bis in den 10 Stock fließt. Muss man aber dann doch bezahlen, also ist das mit den leistbaren Mieten so eine Sache, denn „das konnte man so noch nicht absehen und ein wenig Spielraum “ nach oben, preislich nach oben, muss man schon einkalkulieren, man bekommt schließlich auch was geboten. Die, die jetzt eingezogen, umgezogen sind, und sich die neue – angepasste, natürlich nach oben angepasste – Miete nicht mehr leisten können, die müssen auch nicht verzweifeln, denn dafür gibt es ja die Förderungen, die Förderungen von der öffentlichen Hand, vom Land, das hat da einen Fond, dieser bietet Hilfe und übernimmt einen Teil der oder sogar die ganze Miete. Keine Sorge, wird gezahlt. Da ist diese Hand, diese öffentliche Hand, die fängt letztlich alles auf und damit kann man rechnen oder spekulieren, auf die kann man sich auf jeden Fall bei jedem neuen Projekt verlassen, weil sie letztlich verlässlich niemanden fallenlässt, der sich in so ein Großprojekt hineinbegeben hat, weil da hängen ja Menschen dran, diese Menschen in den Wohnungen, die sich eigentlich die Miete gar nicht mehr leisten können, weiß Klaudia.
Menschen in Setzkästen, eingeteilt, ausgestellt irgendwie, allen Normen entsprechend untergebracht. Wohneinheiten statt Wohnungen, murmelt Klaudia vor sich hin.
Hey, aber dafür gibt es Tiefgaragen, falls man ein Auto hat, und einen Spielplatz mit zwei Spielgeräten, falls man Kinder hat, und betonierte Wege, falls man Skateboard fährt, wenn man allerdings Skateboardfahren wollen würde, wäre das allerdings nicht erlaubt, genauso wie Ballspielen, sollte man vielleicht wissen, sofern man Kinder hat, für Fußball ist mangels Freiflächen allerdings sowieso kein Platz mehr.
Alles auf eine besondere Art abstoßend, eine Schimpftirade kreist in Klaudia Kopf, aber die Menschen werden sich daran gewöhnen, denkt Klaudia, traurig und wütend und denkt an die letzten Jahre, Jahrzehnte, an das, was hier mal erlebbar war. Klaudia wird diesen Teil der Stadt nie mehr betreten, ihre neue Wohnung liegt weit genug davon entfernt, renovierter Altbau, zweiter Stock, mit einem Stiegenhaus wie in Wien. Klaudia hatte sich sofort in die Wohnung verliebt.