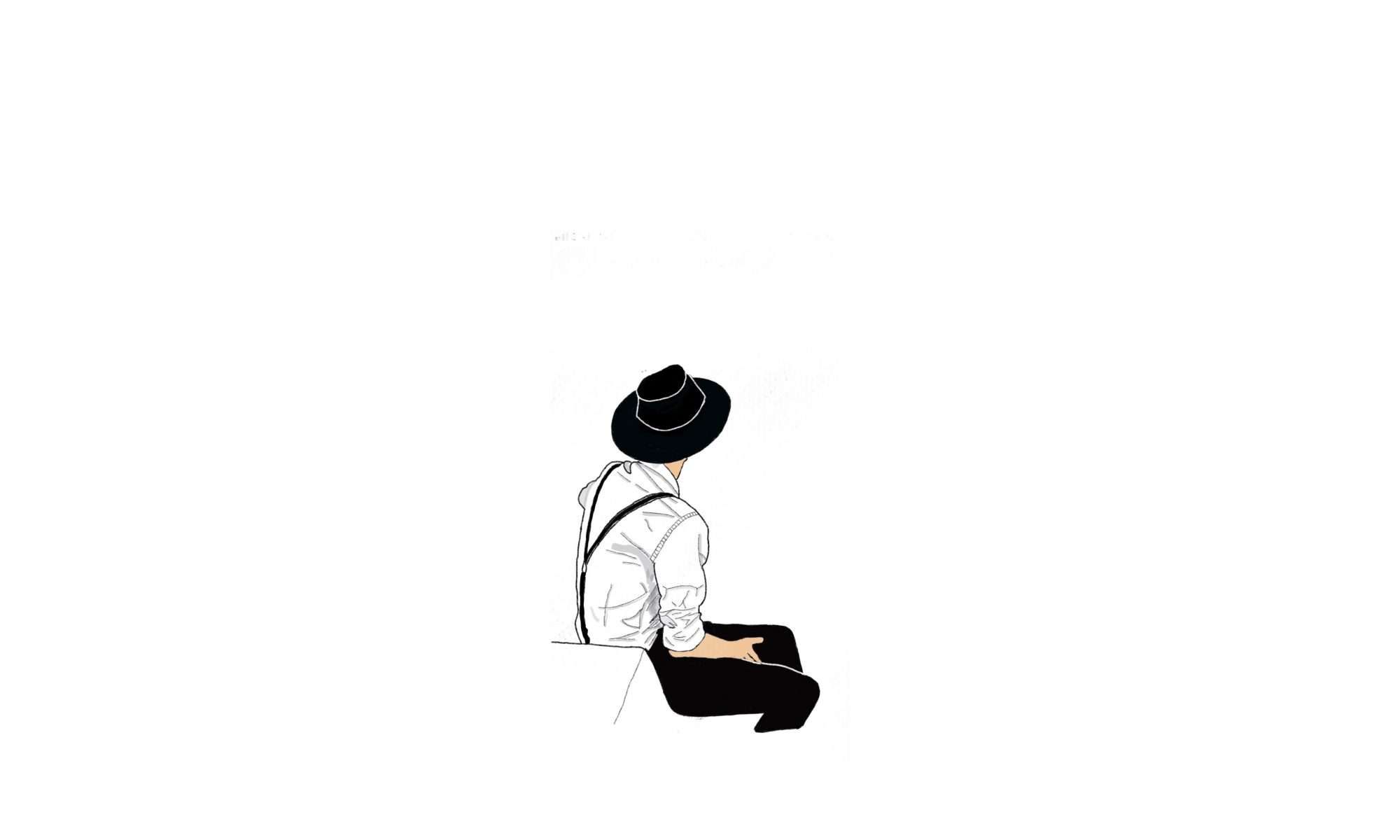Um diese Uhrzeit wäre sie vor einem Jahr wahrscheinlich am Rande einer Tanzfläche gestanden, hätte sich mit jemanden unterhalten, in Erwartung des perfekten Moments beziehungsweise des perfekten Lieds um die letzten Stunden noch zu tanzen. Vor einem Jahr wäre sie in dieser Nachtstunde noch nicht mal ansatzweise müde gewesen.
An der Tankstelle stehend, Automatenkaffee in der Hand arbeitet sie gerade daran, dass sie halbwegs wach wird, wach wirkt, darauf wartend, dass die Stapel an Zeitungen endlich geliefert werden, heute offensichtlich wieder mal verspätet. Es ist 2 Uhr. Nadja studiert den Zettel ihrer aktuellen Tour, darauf sieht man, welche Haushalte ihr Abo beendet oder pausiert haben, welche neuen Zustelladressen dazugekommen sind. Ebenfalls darauf ersichtlich, was man in der letzten Nacht falsch gemacht hat, welche Adressen man vergessen, wo man die Zeitung an den falschen Ort abgelegt hat. Meist arbeitet Nadja sehr genau, manchmal kann es aber passieren, dass man etwas übersieht, nachtformabhängig. Die Abonnenten werden unruhig, wenn sie nicht, wie gewohnt, rechtzeitig zum Frühstück ihre Zeitung bereitliegend haben.
Nadja hat Publizistik studiert, als sie anfing noch mit der vagen Hoffnung oder dem Wunsch Journalistin zu werden, wozu ein Publizistikstudium ohnehin nie der richtige Weg war. Anstatt für Zeitungen zu schreiben, trägt sie nun Zeitungen aus. Als sie den Master in der Tasche hatte, begann für Nadja der Realitätsabgleich, nämlich einen Job zu finden, in dem sie nun arbeiten konnte. Ließ sich aber nicht finden, weder in den Stellenanzeigen der Zeitungen noch am Arbeitsamt. Nachdem sie weder kellnern wollte, was sie während ihres Studiums schon gemacht und immer gehasst hatte, noch weiter auf das erniedrigende, offizielle Service des Arbeitsmarkts bauen, aber nunmal trotzdem Geld und also irgendeine Einkunftsmöglichkeit brauchte, hatte sie sich als Zeitungszustellerin beworden, der Flugzettel dazu wurde ihr absurderweise eines Morgens mit ihrer Zeitung zugestellt. Seit 9 Monaten und 18 Tagen steht Nadja nun Nacht für Nacht auf (es gibt nur wenige Feiertage an denen keine Zeitung ausgeliefert werden muss), steigt in ihr Auto und landet zuerst immer bei der Tankstelle an der Hauptstrasse, wo diverse andere verlorene Nachtarbeiter und NachtarbeiterInnen sich vor allem mit dem zielgenauen Werfen von mit Gummi eingerollten Zeitungen, dem Gerenne durch Treppenhäuser, dem Abzählen von Postkästen und dem Suchen nach Häusern ohne Hausnummer ihr Geld verdienen. Darunter sehr viele Migranten, und verweifelte Mütter (mit Schulden), verzweifelte Väter (mit Schulden), die teilweise auch einem Dayjob nachgehen. Sie alle treffen dabei auf glatte Straßen, unzählige bisswütige Hunde, verschiedenste Alarmanlagen und betrunkene Gestalten. Oder das Auto gibt den Geist auf, mittendrin in der Schicht. Und ein genervter Kollege muss kommen und die Schicht übernehmen, wenn man nicht aus dem kaputten Auto raus, zu Fuß, die restlichen Zeitungen noch rechtzeitig verteilen kann. So ein Auto streikt schnell, die wenigsten haben ein aktuelles Modell, die meisten fahren in ihren Rostschüsseln herum. Unfälle werden nicht abgegolten, es gilt: Man ist in seinem Fahrzeug EinzelunternehmerIn, die die Aufgabe übernommen und dies auch unterschrieben hat, dass man selbstständig ein gewisses Kontingent an Zeitungen verteilt. Reparaturen kann man nicht geltend machen, höchstens dann in seiner Steuererklärung, sofern eine solche bei einer derart niedrigen Belohnung überhaupt Sinn macht. Krankheit interessiert auch niemanden, man hat selbst für Ersatz zu sorgen, schließlich ist man EinzelunternehmerIn, also fährt man eigentlich immer doch selbst. Es wäre auch viel zu aufwendig, jemanden einzuschulen, denn den Plan, wo man zuerst hin muss um dann wie weiter am schnellsten durch die Nacht zu kommen, während sich der Zeitungsstapel am Beifahrersitz, am Rücksitz, im Kofferraum langsam verkleinert. Einmal in der Woche will auch die Gratiszeitung noch zusätzlich ausgetragen werden, an jeden Haushalt, (zusätzliche Last) außer an all jene, die dies explizit vermerkt haben, muss man sich auch noch merken und zuerst mal bemerken.
Es ist im Grunde ein scheinheiliges System in seiner Scheinselbstständigkeit, allerdings auch nicht viel anders wie bei den Paketboten, die Tag für Tag durch unsere Städte jagen im Auftrag von UPS, Hermes, DPD und wie sie alle heißen. Arme Gestalten der Nacht als Schattenzwillinge zu den armen Gestalten des Tages. Den modernen Ausgebeuteten unter uns, von denen niemand vermutet, dass sie es sind. Nämlich im Auftrag aber letztlich auf sich allein gestellt.
Darüber sollten die Zeitungen mal berichten, denkt Nadja Nacht für Nacht, welche Sklaven, welches irre Prekariat sie schaffen, mit ihren Abfallprodukten aus Zeitungspapier, mit ihren Ablaufprodukten am Zeitungspapier.
Wenn die Schicht wieder mal länger dauert als erwartet, wenn wieder mal etwas unerwartetes passiert, steigt in Nadja der Ärger hoch, vielleicht weil sie noch nicht gebrochen ist, weil sie sich mehr erwartet, vor allem Fairness, von einem Leben unter Menschen, weil Nadja weiß, man könnte es besser machen. Eben besser bezahlen, eine bessere Logistik, für den Anfang würde auch unbegrenzt Gratis-Kaffee mal reichen oder Worte der Wertschätzung, neben dem Zapfhahn während man die Stapel hingeknallt bekommt. Stapel voll mit kopierten APA-Meldungen, vollgestopft mit Anzeigen, die Artikel simulieren, mit Artikeln, die Anzeigen verpacken. Seitenweise Hinweise auf die besten Preise. Zeitungsblätter als Werbeblätter. Von gutem Journalismus keine Spur. Von Haltung ist schon lange keine Rede mehr, von Meinungsbildung (mit Betonung auf den zweiten Teil des Wortes), auf die Gatekeeper-Funktion, nämlich Ordnung in eine zunehmend komplexer werdende Welt zu bringen, auf mehr zu verweisen als auf sich selbst. Aber dahin schweift Nadja weit ab, in ihrer Erwartung, an das Produkt, das sie verteilt. Und sie gibt ihren Traum nicht auf, von der Zeitungsausträgerin zur Zeitungsverlegerin. Sie würde es besser machen, denkt sie sich, wenn sie die letzte Zeitung ihrer Tour, wie gewünscht, in einen Plastiksack verpackt und mit Gummiringerl gesichert, direkt vor die Haustür des weißen Hauses mit den zwei Betonlöwen in der Sackgasse ablegt, das immer noch kein automatisches Licht im Garten hat.
Es ist sechs Uhr. Vor einem Jahr wären die Lichter des Club nun angegangen und Nadja wäre ähnlich durchgeschwitzt aber zumindest euphorisiert nachhause gegangen.