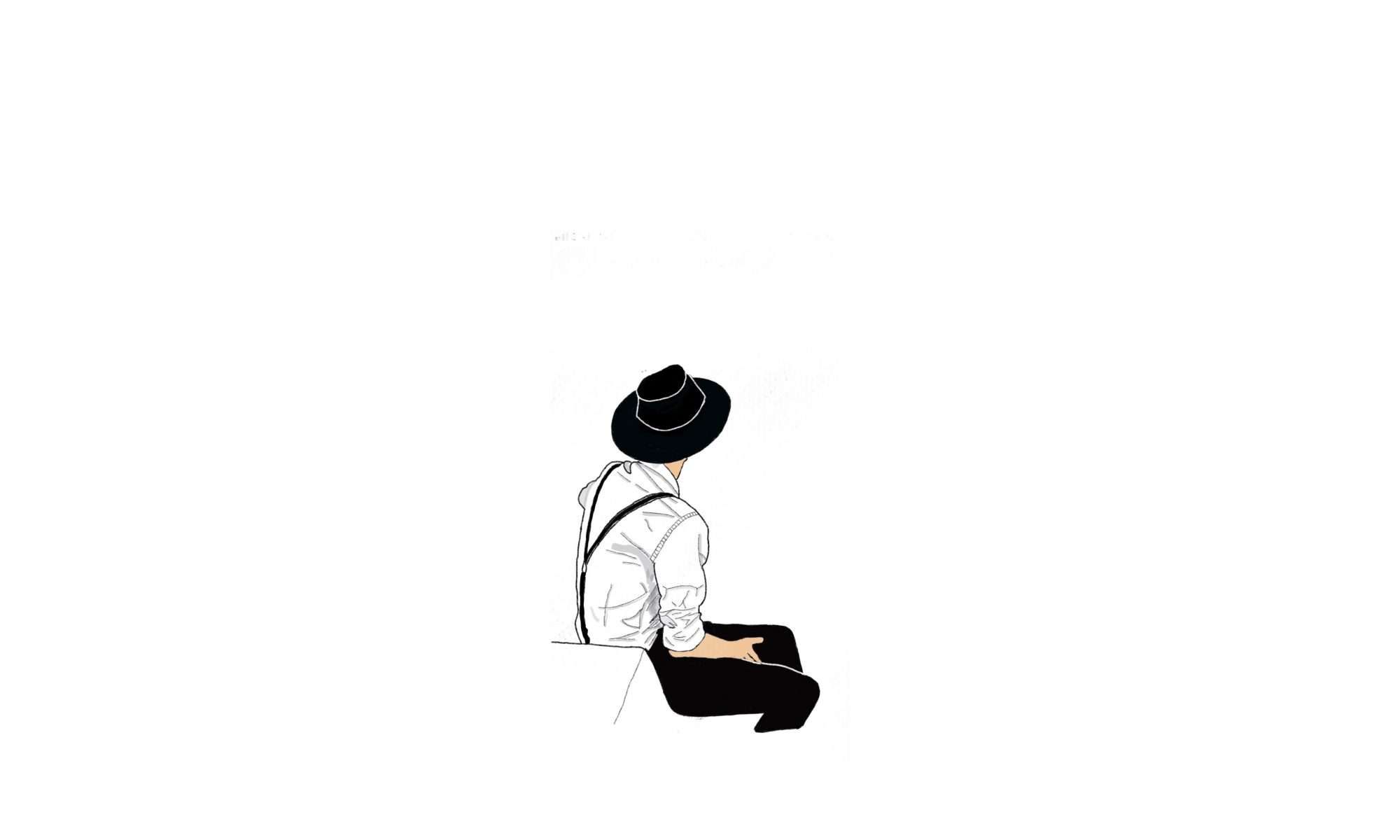Jetzt klatscht niemand mehr. Das ist sie jetzt, die neue Normalität, die sich schon wieder verdammt ähnlich wie die alte Version davon anfühlt. Über zwei Monate lang war Sonja beim AMS gemeldet, nun läuft sie wieder zwischen Gästen im Gastgarten herum, der erweitert wurde, und nimmt Bestellungen auf, die oft genauso langsam oder unfreundlich angesagt werden, wie sie es im Februar dieses Jahres gewohnt war. Da kam Corona und es war schon absehbar, dass es früher oder später auch ihren Arbeitsplatz treffen würde. Zuerst blieben die Gäste langsam aus, dann folgten Maßnahmen auf Maßnahmen und dann durfte ihr Café, also der Platz, an dem sie als Kellnerin arbeitete, gar nicht mehr aufsperren. Plötzlich arbeitslos, ein Zustand, den sie nicht erwartet hatte, etwas, vor dem Sonja eigentlich unglaubliche Angst hatte. Als es dann soweit war, fühlte es sich nicht mehr so schlimm an. Mit ihr verloren hunderttausende ihren Arbeitsplatz, aber der gleichzeitigen Aussicht, dass dies zeitlich begrenzt sein würde. Am Anfang natürlich ungewohnt, kein Wecker am Morgen, freie Einteilung des Tages, allerdings mit der Einschränkung, dass sie ihrer Tochter bei der täglichen Hausübung – die nun gleichzeitig als Schulübung galt – zwischendrin helfen musste. An sich war ihre Tochter sowieso sehr selbstständig, denn wenn sie von der Schule heimkam, machte sie sich meistens selbst das Mittagessen und oft auch das Abendessen, wenn der Dienst im Café wieder länger dauerte. Der Alltag war geprägt von schlechtem Gewissen, ihrer Tochter nicht genug bieten zu können, vor allem viel zu wenig Zeit für sie zu haben. Denn wenn Sonja heimkam, war sie meistens völlig erschöpft und müde und nur noch halbherzig bei den Erzählungen ihrer Tochter dabei, oder dem Wunsch noch etwas gemeinsam zu spielen. Meistens wurde einfach der Fernseher eingeschaltet und man saß noch gemeinsam für eine Stunde zusammen, bis ihre Tochter schlafen gehen musste. Interessanterweise war seit dem Zeitpunkt, an dem „Corona den Job weggenommen hat“, der Fernseher kein einziges Mal in Betrieb gewesen, es hat sich einfach nie ergeben.
Und unglaublich, was Sonja jetzt alles schaffte. Keine liegengebliebenen Wäscheberge, kein Geschirr in der Abwasch, mindestens zweimal am Tag frischgekochtes Essen. All das, was sie sonst nicht bewerkstelligte, sich Vorwürfe machte, warum das andere in ihren Tagesablauf integrieren können und ihr das Gefühl gaben, nicht genug zu leisten, nicht zu genügen, alles falsch zu machen. Wenn Sonja ehrlich nachdachte, hatte sie die Zeit genossen, in der sie gar keine andere Wahl hatte, als daheim zu bleiben. Sie hatte seit Jahren endlich wieder Zeit, frei verfügbare Zeit, Zeit für ihre Tochter und zusätzlich auch noch Zeit für sich. Es gab kein Herumhetzen, kein Stress, niemand, der sie zu irgendwas zwang. Es war durch und durch schön, auch wenn die Lage vor ihrer Haustür noch so bedrohlich anmutete. Interessanterweise hatte sie am Ende des Monats auch noch Geld am Konto, und dies obwohl das Arbeitslosengeld geringer ausfiel als ihr eigentlicher Monatslohn, der aber ohnehin schon niedrig war – und ohne dass sie von irgendeinem Hilfsfond etwas bekommen hätte. Ein Hilfsfonds für alleinerziehende Mütter mit so geringem Einkommen wurde nicht geschaffen. Egal, brauchte sie ohnehin nicht, mit ihrem Plus am Konto am Ende des Monats. Sonja hatte natürlich weniger eingekauft, nämlich tatsächlich nur die Lebensmittel, die sie wirklich brauchte, keine Dinge in Aktion, die irgendwie praktisch schienen und sich beim Diskonter so verlockend abwechseln. Es gab keine Chance zu shoppen, weder neue Schuhe, noch neue Jacken und auch keine neuen Hosen. Ihr Schrank war ohnehin vollgestopft mit dutzenden Varianten von Outfits, die sie selten anzog, und jetzt während der Ausgangseinschränkungen und ihrer vielen Zeit endlich ausmistete, genauso wie all das Zeug, dass sich in den Jahren in ihrer kleinen Wohnung angesammelt hatte und Platz wegnahm. Sie verspürte in sich eine gewisse Art von Befriedigung, tatsächlich nichts zu kaufen, absolut nichts außer Lebensmittel. Sie merkte, dass sie eigentlich nicht viel brauchte.
Sonja verspürte in sich etwas, das lange schon nicht mehr so in ihr präsent war: Glück. Sie war glücklich, mit sich, mit ihrer Tochter, mit ihrer Umgebung. Sie empfand eine Freude zu leben, auch das war gar nicht mehr so selbstverständlich. Einen Satz wie „Die Welt ist schön“, dachte sie sich, als ihre Blumen am Fenster zu blühen anfingen. Dass erst eine Pandemie über die Menschheit hereinbrechen musste, damit Werte wieder als anders definierbar erscheinen. Vielleicht setzt ein Umdenken ein, hatte sie sich lange gedacht, gehofft, sie hatte fast dafür gebetet, denn endlich konnte sie sich ein richtiges Leben vorstellen, das nicht von einer stetigen Abfolge von Aufgaben, von Arbeiten, Abarbeiten, und gleichzeitigen Existenzängsten geprägt sein würde. Und alle erschienen für einen gewissen Zeitraum gleich, ähnlich verletztlich und deswegen hilfsbereit verbunden. Begrifflichkeiten wie „Gefährder“, „soziale Distanz“ und „Reproduktionszahl“ wurden durchmischt mit Diskussionen, die aufatmen ließen: „Bedingungsloses Grundeinkommen“, „Solidarität“, „Achtsamkeit“, „Rücksicht“, „Hilfe“, … Die Menschen können das alles nicht mehr hören, vielleicht konnten sie es nie, genauso wie das Wort der Zeit mit „C“.
Es hätte so schön sein können, es wäre so schön gewesen, gut vorstellbar, es erschien möglich.
Jetzt scheint alles wieder wie immer, keine Rede davon, dass man mal alles ganz grundlegend überdenkt, worin wir leben müssen, keine Blicke über den Tellerrand, außer er ist schmutzig und Sonja wird zum Tisch gerufen. Unter ihrem Schutzvisier klingt sie gedämpft, wenn sie sich entschuldigt und schwitzt, wenn sie schnell zur Bar hetzt um sauberes Geschirr zu holen, das Plastik beschlägt, man sieht ihren Atem, der versperrt ihr die Sicht, ihr Herz schlägt schnell, das sieht man nicht. Sonja ist unwohl.
Die Menschen haben ihre Masken wieder abgenommen, sie trinken ihren Kaffee wie eh und je, neben ihnen stehen die Waren ihrer aktuellen Shoppingtour. Made in China.